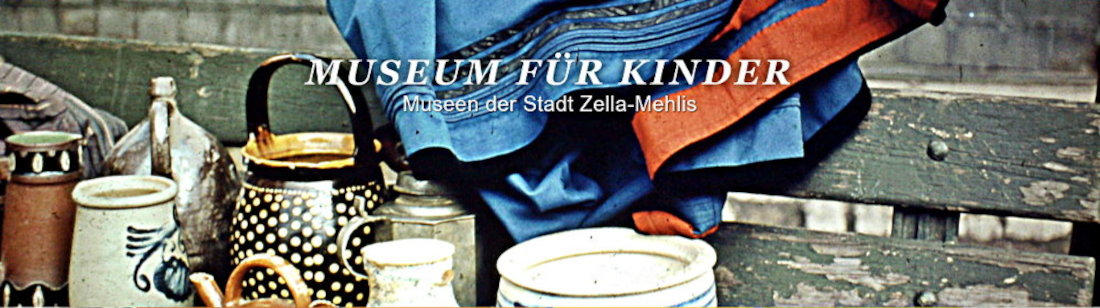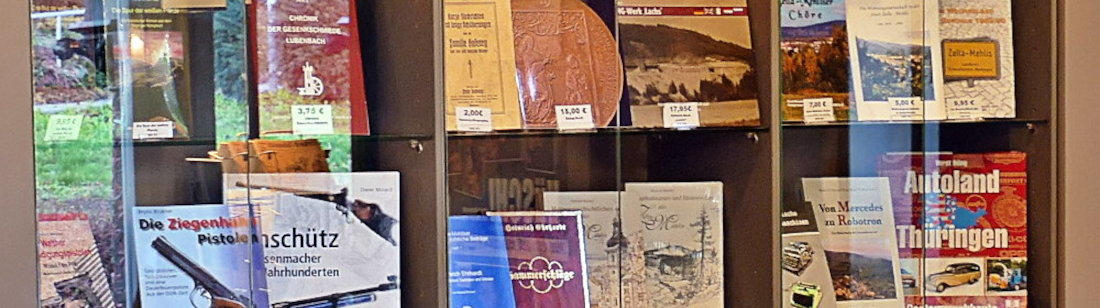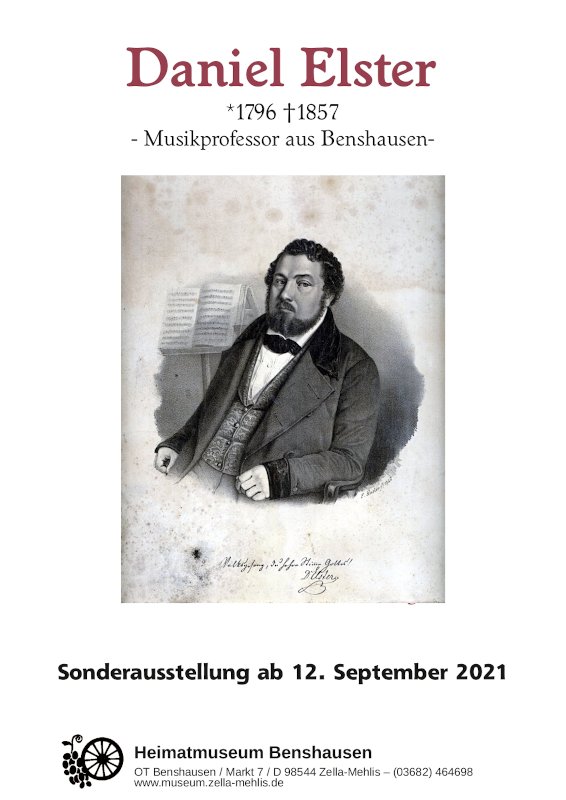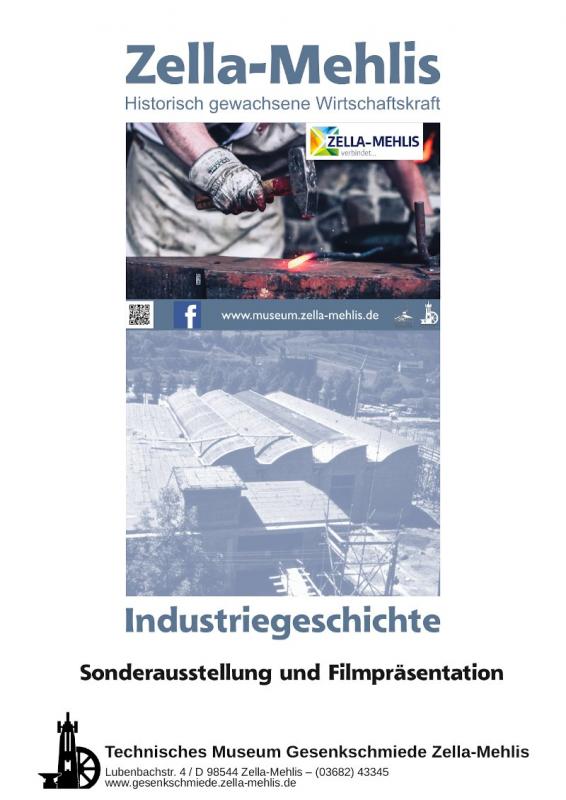Objekt des Monats August 2025 ‒ Bronzebeil

Es wird gesagt, die Menschheit zeichnet die Verwendung und Herstellung von Werkzeug aus. So soll als Objekt des Monats diesmal das zweitälteste Werkzeug unserer Ausstellung im Stadtmuseum näher beleuchtet werden. Es handelt sich um ein bei Schachtarbeiten in einem Garten in Oberzella gefundenes Beil der mittleren Bronzezeit, ein sogenanntes Absatzbeil.
Zeitlich befinden wir uns nach Ötzi (Kupferzeit: um 3200 v. Chr.) und der Himmelsscheibe von Nebra (frühe Bronzezeit: 2100–1600 v. Chr.) in der sogenannten Hügelgräberkultur der mittleren Bronzezeit (1600–1300 v. Chr.). Die Beilformen haben sich in dieser Zeit vom Flachbeil über das Randleistenbeil zum Absatzbeil entwickelt. Das bronzene Metallstück wird in einen abgewinkelten Ast eingeschäftet und mit Lederstreifen, Sehnen oder Ähnlichem und vermutlich (wie bei Ötzis Kupferbeil) mit Birkenteer fixiert. Die seitlichen Leisten verhindern das Verrutschen des Beils, der namensgebende „Absatz“ stützt das Schaftende. So wird bei der Arbeit das Metall nicht weiter ins Holz getrieben. Ob das Beil mit längs stehendem Blatt als Beil oder mit quer stehender Klinge wie bei Dechsel oder Hacke eingeschäftet war, ist heute nicht mehr zu klären. Vielleicht wurde es je nach Bedarf flexibel eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass verschiedene Beiltypen, auch solche aus Stein oder Geweih, über lange Zeit noch parallel verwendet wurden. Bronzebeile waren wertvoll. Hort- und Depotfunde lassen darauf schließen, dass sie auch als Handelsware mit Geldcharakter dienten.

Zeichnerische Rekonstruktion eines Absatzbeils.
Unser Bronzebeil ist im Vergleich zu ähnlichen Fundstücken in Mitteleuropa ein eher großes Exemplar. Es ist 18,8 cm lang, die Schneide ist 4 cm breit, das Gewicht beträgt 440 g. Seitlich zeichnet sich deutlich die Gussnaht ab, es wurde also in eine zweiteilige Dauerform als Schalenguss gegossen. Mittels Passstiften fügten die Metallhandwerker die Sandstein-, Ton- oder Schieferformen genau aufeinander. Von Archäologen wurden aus dieser Zeit sogar zweiseitig nutzbare Gussformen gefunden mit jeweils verschiedenen Negativformen auf Vorder- und Rückseite. Eine Seite diente z. B. zur Herstellung einer Axt, die andere Seite der eines Messers. Außerdem entdeckten sie Tondüsen als Grabbeigaben oder Hortfunde, die – vorn an einem Blasebalg befestigt – dem Anfachen des Schmelzfeuers dienten.
Konserviertes Bronzebeil aus Oberzella in Vorder- und Seitenansicht.
Das durch eine dicke Patina grün gefärbte und heute mit einem schwarzen Überzug konservierte Beil muss man sich ursprünglich goldfarben vorstellen. Die Bronzefarbe variierte je nach den Zuschlägen zum Kupfer. Eine frühe Arsenbronze schimmerte silbrig, Zinnbronze erscheint goldfarben. Die genaue Legierung unseres Museumsbeils ist nicht bekannt. Klassisch nimmt man ein Mischungsverhältnis von neun Teilen Kupfer zu einem Teil Zinn an. Das Verhältnis variiert jedoch und andere Metalle können als Verunreinigung mit enthalten sein. Die Verwendung einer Legierung gegenüber reinem Kupfer war ein deutlicher Innovationsschub.

Virtuelle Rekonstruktion eines goldfarbenen Bronzebeils.
Der Schmelzpunkt von Bronze ist wesentlich niedriger als der des reinen Kupfers. Außerdem gewinnt das Material an Härte und Zähigkeit. Je nach Bearbeitung aus Ausschmieden und mehrfachem Glühen können die Bronzewerkzeuge verfestigt werden und dann vergleichbare Eigenschaften wie weicher Stahl aufweisen. Die experimentelle Archäologie beschäftigt sich mit dem Nachstellen von Legierungen, Herstellungstechniken und deren Ergebnissen und versucht so, der Zeit damals näherzukommen und die Technologien besser zu verstehen. Alle Ergebnisse deuten auf ein enormes Wissen und Können der Menschen zur damaligen Zeit hin. Mit einfachen Mitteln wurde viel geleistet.

Zeichnung „Beim Bronzeschmied“, aus Schlette, Friedrich: „Auf den Spuren unserer Vorfahren“, Berlin 1982, S. 43.
Und nicht nur das. Über die gesamte Bronzezeit muss es für die Rohstoffbeschaffung bereits weitreichende Handelsnetzwerke gegeben haben. Nachweislich wurde Kupfer im Alpenraum abgebaut, das Zinn kam, wie auch das Gold der Himmelsscheibe von Nebra, aus dem Südwesten Englands. Regional sind Abbaugebiete beider Rohstoffe im Erzgebirge denkbar, aber archäologisch wegen späterer Nachnutzung der Lagerstätten schwer nachzuweisen.
Dass die Menschen in der frühen Bronzezeit schon sehr mobil waren und ausgedehnte Netzwerke pflegten, bestätigen neuere Untersuchungen. So kamen Frauen aus dem heutigen Tschechien und dem Raum Halle/Saale über viele hundert Kilometer ins Lechtal (Raum Augsburg), um die dort fest ansässigen Männer zu heiraten. Sicherlich wurden auf diese Weise auch Wissen und Technologien transportiert, wie die der Bronzeverarbeitung.
Vergleichbare Nachweise, allerdings nur anhand von Schmucktypen, gibt es für unsere Region in der Hügelgräberbronzezeit. Die sogenannten Brillennadeln reich ausgestatteter Frauengräber der Fulda-Werra-Gruppe wie in Schwarza zeigen eindeutige Parallelen zu zwei Gräbern im Raum Lüneburg. Auch hier muss es einen engen Austausch gegeben haben. Bei einer Ausgrabung westlich von Magdeburg (ca. 260 km bis Schwarza) wurde ebenfalls eine solche Brillennadel gefunden. Reiche Grabbeigaben aus Bernsteinketten und Glasperlen weisen auf noch weiter reichende Handelsbeziehungen hin. Die Erkenntnisse dazu werden sich dank moderner Analyseverfahren, wie der Metallurgie oder auch der prähistorischen Anthropologie mit Genanalysen und Isotopenanalysen von Zähnen, sicherlich noch vertiefen.

Frauentracht mit Brillennadel nach Funden von Schwarza, © H. Arnold, Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Weimar.
Es muss damals organisierte (Fern-) Routen und Handelswege gegeben haben, die auch über Jahrhunderte Bestand hatten. Einer dieser Wege könnte durch den Zella-Mehliser Raum über den Thüringer Wald hinweg geführt haben. Siedlungen finden sich eher am Fuße des Mittelgebirges und Gebirge gelten als natürliche Grenze von Siedlungsräumen.

Übersicht über Funde der mittleren Bronzezeit im Raum Südthüringen, nach Ebner, Kathrin: „Die mittlere Bronzezeit in Südthüringen“, Dissertation, Marburg 2001, S. 27.
Wie kommt dann das Beil auf die Zella-Mehliser Höhe? Die schartige Schneide des Beils spricht nicht für eine Verwendung als Kultgegenstand, sondern deutet auf eine intensive Nutzung hin. Wofür? Waffe oder Werkzeug? Wurde es unterwegs beim Übergang über das Gebirge verloren, rutschte es einem Händler vom Wagen? Hat sich beim Baumfällen die Bindung gelöst, das Bronzebeil flog ins Gebüsch und ward vom Holzfäller aus Schwarza nicht mehr gefunden? Da es sich um einen Einzelfund handelt, der nicht mit Siedlungsstrukturen, einem Grab oder einem Hort in Verbindung gebracht werden kann, muss dieses Rätsel ungelöst bleiben. (ms)